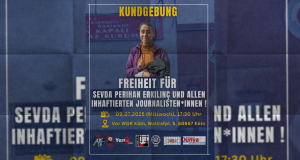Seit über sieben Jahren beraten mehrere Dutzend Staaten bei den Vereinten Nationen (UNO) über ein mögliches Verbot von autonomen Killerrobotern. Die Gespräche haben bis jetzt zu keinen konkreten Verhandlungen geführt, vor allem die großen Militärmächte stehen auf der Bremse. Auch ist unklar, wie ein gemeinsamer Vertrag im Rahmen der »Konvention über bestimmte konventionelle Waffen« (CCW) überhaupt ausgestaltet werden könnte. Am Montag kamen die Vertreter der 125 CCW-Staaten erneut in Genf zusammen.
Tödliche autonome Waffen sind Systeme, die ein Ziel verfolgen und – etwa mit Hilfe künstlicher Intelligenz – über den besten Zeitpunkt eines Angriffs entscheiden. Dabei kann es sich um Drohnen in der Luft, an Land oder auf See handeln. Sie sollen die zu tötenden Personen aufgrund des Aussehens, der Statur oder biometrischer Daten auch selbst identifizieren können.
Anfang Dezember hatten sich die Regierungen im Rahmen einer Expertengruppe bereits in Genf getroffen. Wieder gab es keine Einigung, welchen Weg die Staaten auf dem Weg zu einem gemeinsamen Vertrag beschreiten könnten. Eigentlich sollte die Gruppe Empfehlungen für die seit Montag tagende sogenannte Überprüfungskonferenz der UN-Waffenkonvention erstellen. Im Namen von rund 120 blockfreien Staaten forderte Venezuela am Montag rechtlich verbindliche Regeln, auch Kritiker wie die internationale Kampagne zum Stopp von Killerrobotern sprechen sich für solche aus.
Zunächst müssten sich die Verhandlungsteilnehmer jedoch auf eine gemeinsame Definition von »tödlichen autonomen Waffensystemen« einigen. Die Position der Bundesregierung und anderer Staaten lautet, dass stets ein Mensch die Entscheidung zum Töten geben muss, die Systeme also nicht »vollautomatisch« angreifen. »Letale autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab«, heißt es dazu auch im Ampelkoalitionsvertrag.
Hier beginnt allerdings die Unklarheit: Wenn eine Flugdrohne von einem Soldaten beauftragt wird, ein Fahrzeug zu zerstören und zuvor die Gesichter von Insassen zu überprüfen, handelt es sich dann nicht mehr um einen vollautomatischen Angriff? Doch, sagt Marius Pletsch von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner, die aus Deutschland an der Kampagne gegen Killerroboter teilnimmt. Denn nachdem die Drohne den Tötungsbefehl erhalten hat, ist der Soldat nicht mehr in die Routine eingebunden. Er kann zwar den Angriff abbrechen, ansonsten folgt die Maschine ihrem Auftrag aber selbständig.
Bei der beschriebenen Technik handelt es sich um sogenannte herumlungernde Munition (Loitering munition). Auch die Bundeswehr will sich solche Waffen beschaffen. Das Verteidigungsministerium hat den deutschen Rüstungsdienstleister AMDC mit der Erstellung einer Studie zur Sichtung marktverfügbarer Kamikazedrohnen beauftragt. Einer der Anbieter ist Rheinmetall, dabei starten die Killerwaffen von einem neu entwickelten Drohnenpanzer.
Scheitert die CCW-Konferenz diese Woche, könnte eine mögliche Konvention gegen die tödlichen autonomen Waffensysteme auch in der UN-Generalversammlung oder außerhalb des Staatenbundes angesiedelt werden. Hier wären die Militärmächte zwar nicht dabei, sagt Pletsch. »Aber es könnte eine starke neue Norm geschaffen werden, die langfristige Wirkung auch auf diese Staaten haben kann.«
(Quelle: Junge Welt)
 ATIK | Konföderation der Arbeiter aus der Turkei in Europa |
ATIK | Konföderation der Arbeiter aus der Turkei in Europa |